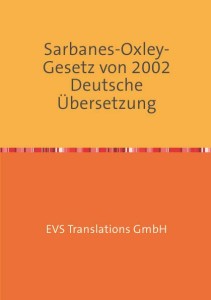Teil II
Was sind die „Zutaten“ für eine gute Übersetzung:
die beruflichen Fertigkeiten des Übersetzers
Diese dreiteilige Reihe beschäftigt sich mit dem Rüstzeug für eine gute Übersetzung und mit der Arbeit eines Übersetzers. In Teil I ging es um die Frage, wie sich die sprachliche Kompetenz eines professionellen Übersetzers von der eines unerfahrenen Übersetzers unterscheiden kann. In Teil II geht es darüber hinaus um die beruflichen Fertigkeiten, nämlich wie ein Übersetzer seine sprachliche Kompetenz in der Praxis anwendet.
EVS Translations arbeitet nach der Norm EN-15038:2006, die besagt, dass ein Übersetzer seine beruflichen Fertigkeiten, die laut dieser Norm verlangt werden, durch mindesten eine von drei Voraussetzungen nachweisen muss:
- Weiterführende Studien der Translationswissenschaft (anerkannter Abschluss)
- Gleichwertige Qualifikation auf einem anderen Spezialgebiet plus mindestens zwei Jahre praktische Erfahrung als Übersetzer.
- Mindestens fünf Jahre praktische Berufserfahrung als Übersetzer.
Die Norm hebt besonders die praktische Berufserfahrung hervor und obwohl es sich von selbst versteht, dass ein Übersetzer ausgezeichnete sprachliche Fähigkeiten besitzen muss, kann das trotzdem nicht ausreichen, wenn er keine Erfahrung in der praktischen Anwendung dieser Fähigkeiten besitzt. Hier sind nur einige der Fertigkeiten, die ein professioneller Übersetzer besitzen sollte:
Er muss Texte von hoher Qualität unter hohem Zeitdruck anfertigen (Einhaltung von Fristen)
In der Übersetzungsbranche geht es meistens um die Einhaltung bestimmter Fristen oder Deadlines. Es ist eine Sache, Informationen effektiv aus einer Sprache in eine andere zu übertragen (wie bereits in Teil I besprochen). Eine ganz andere Sache ist aber, dies unter Zeitdruck tun zu können. Viele weniger erfahrene Übersetzer müssen sich angesichts knapper Lieferfristen geschlagen geben, aber ein professioneller Übersetzer kann innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens arbeiten und trotzdem eine hochwertige Arbeit abliefern.
Er muss versiert sein in der Anwendung computerunterstützter Übersetzungstools (CAT-Tools)
Übersetzungssoftware wird von Übersetzern angewendet, um eine einheitliche Terminologie zu gewährleisten. Hierfür steht eine Vielzahl von Softwarepaketen zur Verfügung und die einzelnen Sprachdienstleister entscheiden sich für unterschiedliche Anbieter, je nach ihren Anforderungen oder den Wünschen ihrer Kunden. Für einen Übersetzer ist es deswegen nichts Ungewöhnliches, nicht mehr in einem herkömmlichen „Word-Dokument”, das gewöhnlich eher für kleinere Projekte geeignet ist, sondern mit unterschiedlichen Softwareprogrammen zu arbeiten.
Er muss in der Lage sein, mit kundenspezifischen Stilvorgaben, so genannten Style Guides, Glossaren und anderen Referenzunterlagen zu arbeiten
Übersetzer müssen lernen, sich nach den Wünschen des Kunden zu richten. Einfach ausgedrückt heißt das: ein unerfahrener Übersetzer fertigt vielleicht einen Zieltext an, von dem er glaubt, dass er eine genaue Übersetzung des Ausgangstextes ist. Ein erfahrener Übersetzer dagegen zieht bei seiner Arbeit immer wieder kundenspezifische Style Guides und anderes Referenzmaterial zu Rate, das ihm vom Kunde überlassen wurde, weil er weiß, dass es bei einer Übersetzung nicht nur darum geht, das sie nicht „übersetzt“ klingt, sondern auch darum, welche Standard-Firmenterminologie der Kunde vorgegeben hat. Gelingt es nicht, die kundenspezifischen Style Guides, Glossare oder Referenzunterlagen korrekt in die Übersetzung einzubinden, so kann das unter Umständen sogar das Produkt-Branding betreffen, weil die von einem unerfahrenen Übersetzer verwendete Terminologie möglicherweise nicht mit anderen, vom Kundenunternehmen veröffentlichten Materialien übereinstimmt.
Die oben erwähnten Fertigkeiten können durch Berufserfahrung immer weiter perfektioniert werden und werden deswegen in der Industrienorm EN-15038:2006 besonders hervorgehoben. Klar ist, dass die Norm EN-15038:2006 einen fach- und sachkundigen Übersetzer nicht nur anhand der Zahl der Jahre definiert, die er eine fremde Sprache beherrscht, sondern anhand seiner fachlichen Qualifikationen und/oder soliden praktischen Berufserfahrung, und das aus einem ganz einfachen Grund: als Garantie für Qualität.
Ein Ausblick auf Teil III
Eine Zutat fehlt noch in unserem Rezept für eine Qualitätsübersetzung: das interne Übersetzungssystem. Teil III unserer Reihe beschäftigt sich daher mit der Frage, warum die richtige Umgebung einem Übersetzer dabei hilft, eine perfekte Übersetzung abzuliefern.
Sashimi – Wort des Tages
Sashimi ist eines der bekanntesten und beliebtesten Gerichte Japans. Für ausländische Besucher kann es allerdings eine Herausforderung darstellen, wenn es darum geht, etwas zu essen, das man nicht kennt, und dabei gleichzeitig höflich zu lächeln.
1880 veröffentlichte die faszinierende britische Entdeckerin und Schriftstellerin Isabella Lucy Bird ihr Buch Unbeaten tracks in Japan und beschrieb darin erstmalig Sashimi in englischer Sprache als „längliche Streifen von rohem Fisch”. Wie man an folgender Aussage erkennt, hatte Bird von der japanischen Küche ohnehin keine gute Meinung: „Die Küche des 'gut situierten' Japaners ist zwar nicht unbedingt als abscheulich zu bezeichnen, doch haben die Speisen etwas für Nicht-Japaner so Ungenießbares, dass man als Engländer erst nach längerer Erfahrung das japanische Essen mehr oder weniger kleinlaut zu sich nimmt”.
Sashimi besteht tatsächlich aus rohem Fisch und Meeresfrüchten, z.B. aufgeschnittenem Fisch, Schalentieren und Rogen, alles wunderschön angerichtet auf einem Bett aus zerkleinertem Daikon (weißer Rettich) und dekoriert mit pikanten Perillablättern. All dies wird auf einer großen Servierplatte dargeboten und ist mit seiner Farbigkeit, der exakten Anordnung der Zutaten und der Vielfalt der Fische und Meeresfrüchte Zentrum und Blickfang einer Mahlzeit, insbesondere wenn es für eine große Anzahl von Personen arrangiert wurde.
Anders als Sushi, das aus geschnittenem rohem Fisch oder anderen Meeresfrüchten hergestellt wird, die man um kleine Klumpen aus mit Essig abgeschmecktem Reis legt, besteht Sashimi nur aus Fisch und Meeresfrüchten, und man serviert dazu einfachen Reis in kleinen Schüsseln. Angesichts der appetitlichen Vielfalt der angebotenen Meeresfrüchte ist es nicht leicht, sich beim Essen von Sashimi zurück zu halten, damit die übrigen Gäste ihren Anteil abbekommen, man selbst aber nicht zu kurz kommt. Ausländische Besucher zu Sashimi einzuladen, ist daher immer eine gute Idee, da sie beim Essen zunächst eher zögerlich sind und bei Seeigel, Lachsrogen, Shrimps und Thunfisch weniger häufig zugreifen –was bedeutet, dass man selbst eventuell etwas mehr zuschlagen kann!
Sashimi wird in erstklassigen Sushi-Restaurants serviert, aber auch im Izakaya (einer Art Kneipe im japanischen Stil). Es gibt also Sashimi für jeden Geldbeutel. Weil Sashimi jedoch sehr leicht ist und man am Ende keinen vollen Magen hat, ist es sicher nicht so günstig wie beispielsweise Sushi oder andere bekannte japanische Gerichte.
Und trotz des vernichtenden Urteils von Isabella Lucy Bird über die japanische Küche hat sie in einem Punkt Recht: nach längerer Erfahrung mit japanischem Essen ist dieses frische und gesunde Festessen aus dem Meer auch für Nicht-Japaner ein Genuss.
Was sind die „Zutaten“ für eine gute Übersetzung?
In dieser dreiteiligen Reihe haben Sie Gelegenheit, die Arbeit des Übersetzers näher kennen zu lernen. Sie erfahren, um was es bei der Übersetzung eines Textes aus der Ausgangssprache in eine Zielsprache geht und wir werden die Frage stellen: „Wie kommt man zu einem guten Ergebnis?”
Diese Artikel sollen Ihnen ein besseres Verständnis dessen vermitteln, was Übersetzen ist und was die Voraussetzungen für eine gute Übersetzung sind.
Teil I Was sind die „Zutaten“ für eine gute Übersetzung: die sprachliche Kompetenz
Teil II Was sind die „Zutaten“ für eine gute Übersetzung: die beruflichen Fertigkeiten des Übersetzers
Teil III Was sind die „Zutaten“ für eine gute Übersetzung: das betriebliche Umfeld
Teil I Was sind die „Zutaten“ für eine gute Übersetzung: die sprachliche Kompetenz
Berichte über die Preiskämpfe der Supermärkte sind nichts Neues. Fast wöchentlich scheinen sich die Großen der Branche gegenseitig zu überbieten und wollen ihre Ware noch günstiger anbieten, als die Konkurrenz. Einige wollen den Kunden weismachen, mit den höheren Preisen zahle man schließlich nur für den Markennamen. Aber haben Sie schon einmal die Zutatenliste einer bekannten Marken-Tomatensauce mit der günstigeren Eigenmarke des Supermarkts verglichen? Mit der Übersetzungsbranche ist es wie mit der Tomatensauce: die Qualität ist sehr unterschiedlich und es gibt gute Gründe für die Preisunterschiede.
Wer eine Übersetzung benötigt, unterschätzt häufig, wie viele Kenntnisse und Qualifikationen notwendig sind, um eine Übersetzung von hoher Qualität anzufertigen. Der um sich greifende Trend zu Billigübersetzungen, beispielsweise durch Crowd Sourcing, kann dazu beitragen, die fachlichen Standards zu unterminieren. Aber man muss wissen, dass gute Übersetzungen in erster Linie professionelle Übersetzer erfordern. Wenn Sie nur für 5 % Tomaten bezahlen möchten, können Sie nicht 80 % erwarten.
Aber was ist ein „professioneller Übersetzer” eigentlich? Vielleicht kann man dieses Kriterium in zwei Bereiche unterteilen: sprachliche Kompetenz und berufliche Fertigkeiten. In Teil I beschäftigen wir uns mit der sprachlichen Kompetenz.
Bei EVS Translations ist der Schlüssel für eine perfekte Übersetzung die Qualität der einzelnen „Zutaten”. Die Investition in talentierte Linguisten ist also unabdingbar. Aber wenn es um das Übersetzen geht, kann der Begriff „talentierter Linguist” nicht nur anhand der sprachlichen Qualifikation definiert werden, denn diese allein macht noch keinen guten Übersetzer aus. Man sollte also nicht annehmen, dass jemand mit einem akademischen Abschluss in Sprachen ein technisches Handbuch von 10.000 Wörtern aus dem Italienischen übersetzen kann, nur weil er Italienisch spricht.
Die Fähigkeit, einen fremdsprachlichen Text zu lesen und die darin enthaltene Information in die Zielsprache zu übertragen, ist keine leichte Aufgabe und bis man es beherrscht, braucht es schon einige Zeit. Die Strukturen von Ausgangssprache und Zielsprache sind unterschiedlich und können kulturelle Referenzen oder Begriffe enthalten, die in der Zielsprache keinen Sinn ergeben oder gar nicht vorkommen. Für weniger erfahrene Übersetzer kann es sich daher als schwierige Aufgabe erweisen, eine Übersetzung anzufertigen, die für den zielsprachlichen Leser nicht ‚übersetzt‘ klingt.
Ein erfahrener Übersetzer ist in der Lage, genau die Mitte zwischen wörtlicher und freier Übersetzung zu finden, so dass die Übersetzung die Erwartungen des Zielpublikums erfüllt.
Das richtige Übertragen von Informationen aus einer Ausgangs- in eine Zielsprache ist aber noch nicht alles. Das wichtigste, was ein angehender Übersetzer lernen muss, ist, wie er seine sprachlichen Fertigkeiten mit Erfolg in der Praxis anwenden kann.
Und damit kommen wir zu Teil II
Teil II dieser Reihe befasst sich mit den beruflichen Fertigkeiten eines Übersetzers sowie mit Kriterien, die seine fachliche Kompetenz entsprechend der Industrienorm EN-15038:2006 betreffen.
UFO – Wort des Tages
UFO ist die Abkürzung für Unbekanntes Flugobjekt, bezieht sich jedoch nicht notwendigerweise auf ein Raumschiff von Außerirdischen. Aber genau das wird heutzutage gewöhnlich unter der Abkürzung verstanden. Für manche gehören UFOs in das Reich der Fantasie, für andere wiederum sind sie ganz real und beobachten unseren Planeten bereits seit Jahrhunderten. Und natürlich gibt es immer wieder Menschen, die behaupten, sie wären letzte Woche an Bord eines UFOs gewesen und hätten mit einem kleinen grünen Männchen gesprochen. Was aber ganz sicher stimmt, ist der Zeitpunkt, an dem der Begriff in England zum ersten Mal in der Presse auftauchte. 1953 beschrieb Donald Edward Keyhoe (1897-1988), ein amerikanischer Marineflieger und Schriftsteller, in dem Magazin Airline Pilot die Sichtung eines UFOs: „Das UFO befand sich schätzungsweise zwischen 12.000 und 20.000 Fuß über den Triebwerken”. Keyhoe hatte bereits früher, im Jahre 1949, zum Thema UFOs einen sehr populären Artikel in dem Magazin True geschrieben, mit dem Titel Flying Saucers Are Real*, aber es dauerte noch ein paar Jahre, bis der Begriff UFO in den allgemeinen Sprachgebrauch überging. Tatsächlich war es ein Offizier der US Air Force, nämlich Captain Edward J. Ruppelt, dem wir den Begriff UFO verdanken. Ruppelt war der führende Kopf des Project Blue Book, einem Projekt der United States Air Force, das unbekannte Flugobjekte untersuchte. In seinem Report on Unidentified Flying Objects schrieb er 1956: „UFO ist die offizielle Bezeichnung, die ich als Ersatz für den Begriff der ‘fliegenden Untertassen’ geschaffen habe”.
Zwar hatte Keyhoe anfänglich nur ein allgemeines Interesse am Thema UFO, doch war er später Mitbegründer des National Investigations Committee on Aerial Phenomena, dem Nationalen Untersuchungsausschuss für Luftphänomene, weil er der Meinung war, am Himmel beobachtete UFOs stammten aus dem All. Die US-Regierung war allerdings bestrebt, dies zu vertuschen. Als man Ruppelt anbot, für dieses Komitee als Berater tätig zu sein, lehnte er das Angebot ab.
Leider konnte die Frage, ob UFOs tatsächlich existieren oder ob sie aus dem Weltall kommen, bisher noch nicht beantwortet werden, obwohl es an Verschwörungstheorien rund um das Thema nie mangelte.
Das SETI-Institut (Search for Extraterrestrial Intelligence) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kalifornien, die seit 1984 den Himmel mit Radio- und Teleskopausrüstungen abtastet, um den Beweis für Signale von einem außerirdischen Raumschiff zu finden. So stellt sich die Frage: wenn seit diesem Zeitpunkt UFOs in unseren Sphären unterwegs gewesen wären, hätte dann nicht dieses Institut (und andere Organisationen, die weltweit SETI-Projekte verfolgen) als Erstes davon erfahren müssen? Können wir wirklich denjenigen glauben, die während einer Fahrt im Auto plötzlich ein außerirdisches UFO gesehen haben wollen, während Wissenschaftler mit ihren Geräten zuschauten?
Auf konkrete Beweise für UFOs aus dem All werden wir wohl noch warten müssen, aber bevor wir die Außerirdischen tatsächlich einladen, uns hier auf der Erde zu besuchen, sollten wir vielleicht an die weisen Worte von Professor Stephen Hawking denken, der einmal gesagt hat: „Wenn uns Außerirdische besuchen, wäre das ungefähr wie die Landung von Columbus in Amerika, und wir erinnern uns, dass dies für die Indianer nicht wirklich gut ausging”.
*Fliegende Untertassen gibt es wirklich
Gaga – Wort des Tages
Wahrscheinlich denken viele bei unserem heutigen Wort des Tages zunächst an Lady Gaga.
Die bekannte Künstlerin machte in den letzten Wochen wieder ziemlich häufig von sich reden, angefangen von ihrem Outfit für die Verleihung der Oscars-und ihrer staunenswerten Performance bis zu ihrem Sprung ins eiskalte Wasser des Lake Michigan in Chicago anlässlich eines Charity-Events.
Nun, Lady Gaga hat in den letzten Jahren wirklich einige ziemlich verrückte Vorstellungen abgeliefert. Und diese entsprechen ziemlich genau den verschiedenen Bedeutungen des Wortes gaga. Denn einige kann man ganz einfach als albern und ziemlich irre bezeichnen, andere als übertrieben pathetisch oder naiv, und wiederum andere gingen zu weit, als dass man sie einfach als senil und schrullig bezeichnen könnte.
Zwar leitet sich der Künstlername des Popstars von dem Queens-Song Radio Ga Ga ab, doch ist Lady Gaga genauso bunt und facettenreich, wie es ihr Pseudonym bereits ahnen lässt.
Das Wort gaga in der Bedeutung von schrullig oder kauzig stammt aus der französischen Sprache des 19. Jahrhunderts und beschreibt die Babysprache, bei der Laute wie „ga” z.B. in Worten wie gâteux (senil) oder gâtisme (altersschwache Person) verdoppelt werden.
In dem 1905 veröffentlichten enzyklopädischen Wörterbuch der französischen Sprache Le Petit Larousse wird die Bedeutung des Wortes gaga folgendermaßen erklärt: Homme tombé en enfance (Mann, der wieder in seine Kindheit zurück gefallen ist).
Mit anderen Worten, das menschliche Leben beginnt und endet mit einem gaga-Zustand, ganz zu schweigen von den vielen ‚gaga‘ Stationen auf dem Weg dorthin (wie beispielsweise schwärmerische Liebe oder überschwängliche Begeisterung).
Direkt nach seiner offiziellen Aufnahme in das französische enzyklopädische Wörterbuch wurde das umgangssprachliche Adjektiv gaga in die deutsche und die englische Sprache übernommen, wobei die erste offizielle schriftliche Erwähnung in Englisch aus demselben Jahr stammt. Am 18. März veröffentlichte der Daily Chronicle in London eine Rezension der Londoner Theaterszene: „Ah, Ihr Engländer,.....Ihr liebt es, zu lachen—ga-ga!.. Ist das nicht der pathetische Schrei unseres gegenwärtigen Dramas, Ga-ga!”
In den folgenden Jahrzehnten wurde das Wort in beiden Bedeutungen verwendet – seniler Verfall alter Männer und albernes Verhalten.
1921, Maurice Baring in Passing By: „Sir Arthur ist ziemlich gaga und hielt mich den ganzen Abend lang für George”. Und Edna Ferber in Show Boat, 1926: „Nola Darling, Du bist soeben gaga geworden, das ist alles. Wie sonst könnte es Dir einfallen, da unten in dieser elenden, malariaverseuchten Hitze zu bleiben!”
In der modernen englischen Sprache wird der Begriff gaga meistens im Sinne von „wegen etwas völlig gaga werden” (auf etwas sehr positiv oder mit übertriebener Begeisterung reagieren) verwendet. Und wir hoffen natürlich, dass es unseren Lesern bei unserer Reihe „Wort des Tages” genauso geht.
Casino – Wort des Tages
In dem Wort Casino steckt Magie, oder doch zumindest der Duft nach Geld und der Erfüllung von Träumen (leider meist der modrige Geruch geplatzter Träume).
Auf den ersten Blick scheint es logisch, dass dieser Begriff etwas mit Geld, Kasse/Kassenschalter zu tun hat. Aber nach der Wortherkunft scheint er ganz andere Wurzeln zu haben. Das Wort casino stammt vom italienischen Wort Casa – ein Haus, in dem man sich vergnügt, oder auch ein Ferien-/Sommerhaus, vom lateinischen casa – Hütte, Ferienhaus. Die erste nachweisliche Verwendung in der englischen Sprache stammt von 1789, und bedeutete ‚öffentlicher Raum‘ oder ‚Club‘ als sozialer Treffpunkt und für Tanzveranstaltungen. Und es war die britische Tagebuchschreiberin und Kunstmäzenin Hester Lynch Thrale, später bekannt unter dem Familiennamen ihres italienischen Ehemannes, Piozzi, die ihre Eindrücke von einer Gondelfahrt auf dem Canale Grande in Venedig in ihrem Reisetagebuch festhielt: „Die nächtlichen Treffpunkte, das Kaffeehaus, und das Casino..... (welche die Schönheit des Canale Grande unterstreichen)”.
Leider war zum Zeitpunkt ihres Aufenthalts in Venedig das erste bekannte europäische Spielcasino - Das Ridotto in Venedig - welches 1638 eröffnet worden war, um während des Karnevals in Venedig das Glücksspiel unter Kontrolle zu halten, bereits seit über zehn Jahren geschlossen. Es wird nicht ganz klar, ob Mrs. Piozzi ein Spielcasino oder aber ein venezianisches Bordell meinte.
Kurios ist jedenfalls die Tatsache, dass im heutigen Italien mit casino Letzteres gemeint ist, während das eigentliche Spielcasino mit einem Akzent, casinò, geschrieben wird. Jedenfalls dienten Casinos, in der einen oder der anderen Bedeutung des Wortes, der Unterhaltung und waren in ganz Europa verbreitet.
So heißt es in einem europäischen Reisebuch von 1836: „In allen wichtigen deutschen Städten kann man Vereinigungen, beinahe vergleichbar mit einem Londoner Club und häufig als Casino .......oder ähnlich bezeichnet, finden.” Die erste dokumentierte Erwähnung des Wortes casino in der englischen Sprache mit der Bedeutung Spielcasino stammt wieder aus Venedig, aber 62 Jahre später. Der viktorianische Autor und Kunstkritiker John Ruskin reiste mit seiner Ehefrau nach Venedig. Er wollte den Versuch starten, das ästhetische Ideal des viktorianischen Zeitalters zu definieren. Und wie es aussah, hatte dieses Ideal viel mit dem Spielen zu tun, denn in einem Brief in seine Heimat im Jahr 1851 findet sich der Satz: „Er verlor beim Spielen in Chamonix 25.000 Francs an den Casinomeister.”
Nugat – Wort des Tages
Nugat oder nicht Nugat, das ist hier die Frage – wo liegt der Ursprung des Weichkonfekts, und gibt es den besten in Italien oder in Frankreich?
Der am meisten verbreitete, der weiße Nugat – hergestellt aus geschlagenem Eiweiß und Honig – kam im frühen 15. Jahrhundert aus Italien. Der Legende nach wurde die Leckerei zum ersten Mal anlässlich einer Hochzeitsfeier in Cremona im Jahre 1441 hergestellt und zwar in Form des Glockenturms der Stadt. Diesen Turm nannte man Torrazzo, daher die Bezeichnung Torrone.
Doch es gibt noch eine andere Version, die ähnlich wie das Nugatkonfekt ein traditionelles Produkt aus der heutigen Benevento-Region war und von den lateinischen Autoren bereits im 1. Jahrhundert unter dem Namen cupedia beschrieben wurde. Und natürlich stammt die erste schriftliche Erwähnung von Nugat sowie auch das erste Rezept in englischer Sprache von 1827 aus The Italian Confectioner von Guglielmo A. Jarrin und seiner Complete economy of desserts: „Kuchen-Nugat: Dieser Nugat kann in Formen oder in kleinen Quadraten hergestellt werden. ”
Auch bei den Griechen war seit dem 9. Jahrhundert ein dem Nugat sehr ähnliches Dessert bekannt, und wo immer man in Italien unterwegs ist, findet man viele verschiedene Varianten dieser Süßigkeit. Aber es war der französische Weichnugat, der die Welt eroberte. Es wird vermutet, dass Anfang des 17. Jahrhunderts das orientalische Dessert aus Zucker und Nüssen, Halwa oder Halva, nach Marseille importiert wurde und man in der Region mit der Produktion einer eigenen Variante dieses Desserts begann, bestehend hauptsächlich aus Zucker und Walnüssen. Man nannte es nux gatum (Walnusskuchen).
Anfang des 18. Jahrhunderts ersetzte man die Walnüsse durch Mandeln, deren Produktion in Italien weit verbreitet war, und so war der französische Nugat geboren, der die Welt eroberte. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis das neue Mandelrezept den britischen Lesern vorgestellt wurde, und zwar 1846 in French Domestic Cookery: „Bei der Herstellung von Nugat in großen Mengen sollte man die Mandeln jeweils nur in kleinen Mengen dazugeben.” Heute gibt es unzählige Varianten von Nugat – mit Nüssen und Trockenfrüchten, mit verschiedenen Mischungen aus Kakao und Kaffepulver, bis hin zur deutschen Haselnussnugatpraline. Die Süßigkeit ist glutenfrei und Anhänger der Paleo-Diät können den Zucker durch Honig ersetzen.
Der fallende Ölpreis und seine Bedeutung für die Weltwirtschaft
Vom Rohstoffhändler bis zum Endverbraucher, der auf dem Weg zur Arbeit seinen Tank füllt, hat jeder den jüngsten dramatischen Preisverfall des Öls mitbekommen. Seit etwa 2010 bis Mitte 2014 kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent durchschnittlich 110 $. Vor kurzem sackte der Durchschnittspreis unter 50 $ ab, ein Rückgang von etwa 55 % während der letzten 6-7 Monate. Da Öl- und Benzinpreis aneinander gekoppelt sind, fallen auch die Benzinpreise, was den Endverbraucher natürlich jubeln lässt. Aber was bedeutet das alles für die Wirtschaften der einzelnen Länder der Welt?
Für Länder, die von der Ölproduktion abhängen und seit langem auf die Gewinne der Energieindustrie angewiesen sind, kann diese starke Preisschwankung wirtschaftlich von Nachteil sein, insbesondere in Kombination mit einer unzureichenden Finanzplanung. Länder, bei denen beispielsweise die Ölgewinne Grundlage eines Ausgabeplans sind, z.B. Venezuela und Nigeria, sehen sich bereits jetzt vor möglichen Unruhen, da sie gezwungen sind, sich entweder für Ausgabenkürzungen oder für eine Kombination aus Steuererhöhungen und Subventionskürzungen zu entscheiden. Am anderen Ende des Spektrums stehen Länder wie Saudi Arabien (und, in geringerem Maß, Russland), das sich auf einen Abschwung wie diesen durch die Einrichtung eines Reservefonds – geschätzte 700 Mrd.$- vorbereitet hat, der es ihnen ermöglicht, das gegenwärtige Ölproduktionsniveau zumindest für ein paar Jahre aufrecht zu erhalten, ohne Nachteile für die einheimische Wirtschaft und die geplanten Ausgaben.
Im Normalfall wären niedrige Erdölpreise den Ölverbraucherländern höchst willkommen. Doch leider ist es die eigene schwache Wirtschaftslage vieler führender Länder der globalen Wirtschaft, die zu diesem Ölpreisverfall geführt hat. Sowohl die Chinesen als auch Verbraucher in der EU werden von den niedrigeren Kraftstoffpreisen profitieren, aber die zugrunde liegenden Probleme sind trotzdem vorhanden. Man erwartet, dass das chinesische Wirtschaftswachstum, das 2010 10,4 % und 2011 9,3 % betrug, 2015 unter 7 % sinken wird, ein deutlicher Rückgang. Die EU arbeitet derzeit an einem Programm zur geldpolitischen Lockerung, das monatlich 60 Mrd. $ zur Ankurbelung der europäischen Wirtschaft vorsieht. Die Vereinigten Staaten, bisher größter Ölimporteur der Welt, konnten ihre Abhängigkeit von Fremdenergie durch die einheimische Schieferölproduktion lockern und dadurch ihre Wirtschaft gegen Ölkrisen abschotten. Doch obwohl sich Amerika anscheinend von der letzten Rezession erholt hat, zeigt sich bei einer Reihe von Schlüsselfaktoren, wie beispielsweise der Erwerbsquote, dass es noch ein weiter Weg bis zum tatsächlichen Wachstum ist.
Berücksichtigt man all diese Aspekte, dann hängt es tatsächlich von der Perspektive ab, welche Bedeutung billiges Öl für eine Wirtschaft hat – für den privaten Verbraucher kann es sich positiv auswirken, denn es könnte bei der Kostensenkung helfen, aber für das Land als solches kann es schlecht sein, denn Öl ist ein Produkt, das für geringere Ausgaben und eine schwache Wirtschaft steht. Laut IWF führt ein Ölpreisrückgang von 10 $ theoretisch zu einem Weltwirtschaftswachstum von 0,2 % (demnach müsste die Weltwirtschaft 2015 um etwa 1 % wachsen). Doch erst kürzlich hat der IWF das Weltwirtschaftswachstum um 0,3 bis 3,5 % in 2015 nach unten korrigiert. Es sieht leider so aus, als würde der Anreiz des billigen Öls von der schwachen Wirtschaft überholt, und sobald sich die Hauptantriebskräfte der Weltwirtschaft erholen, wird auch der Ölpreis nachziehen.
Futuristisch – Wort des Tages
Futuristisch – Wort des Tages – Vergleicht man den Ausblick des Films Zurück in die Zukunft auf das Jahr 2015 und die vorausgesagte Beherrschung unseres Lebens und unserer Realität durch die Technik, mit dem, was wir heute vorfinden, dann muss man sagen, dass die Realität manchmal noch futuristischer ist als das, was wir uns vor ein paar Jahren vorstellen konnten.
Die Bedeutung von futuristisch als ein Begriff, der sich auf Zukunftsvoraussagen bezieht, findet sich zwar erst seit ungefähr 1950 in unserer Sprache, aber das Wort selbst feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.
Das Adjektiv futuristisch tauchte in der englischen Sprache zur Beschreibung der avantgardistischen künstlerischen und gesellschaftlichen Bewegung auf, die in Mailand 1909 von dem italienischen Dichter Filippo Tommaso Marinetti ins Leben gerufen und in seinem Futurist Manifesto proklamiert wurde.
Diese Bewegung, die im Italienischen als Futurismo und im Englischen als Futurism bezeichnet wurde, hatte sich die Abschaffung des Alten zum Ziel gesetzt und feierte das moderne industrielle Leben mit seinem technologischen Fortschritt und der urbanen Modernität, der Schönheit von Maschinen, Schnelligkeit und Kraft, und sie reichte von der Architektur bis zur Malerei und den Produkten des täglichen Lebens.
1915 veröffentlichte der amerikanische Kunstkritiker Willard Huntington Wright, besser bekannt durch seine Detektivromane und unter dem Pseudonym S. S. Van Dine, Modern Painting: Its Tendency and Meaning - eine Übersicht über die wichtigsten Bewegungen in der Kunst der letzten hundert Jahre, in der das von 1912 stammende Gemälde von Albert Gleizes Man on a Balcony (L'Homme au balcon) als „in seiner Konzeption beinah futuristisch” bezeichnet wurde. Und tatsächlich gehörte der französische Künstler und Philosoph Gleizes zu den Gründern des Kubismus.
Futuristisch behielt während der kommenden 5 Jahrzehnte seine Bedeutung ‚ultramodern, avantgardistisch‘ für alles von der Musik (im Februar 1928 rezensierte das britische Magazin Melody Maker einen Song als „ziemlich futuristische Harmonie”) bis zur Mode (1968, Janey Ironside, A fashion alphabet: „Kleidungsstücke, einerseits futuristisch, und doch erinnernd an eine Rüstung und einen Kettenpanzer”).
Als ein Begriff, der sich auf Zukunftsvorhersagen bezog, wie am Anfang erwähnt, erschien futuristisch 1958 erstmalig in gedruckter Form in der Dezemberausgabe der BBC-Fernsehzeitschrift The Listener, wo Ereignisse wie das Mitführen eines optischen Teleskops in Erdsatelliten oder dessen Aufstellung auf dem Mond als „futuristische Unternehmungen” bezeichnet wurden. Und ja, Hubble wurde 32 Jahre später gestartet – wir leben also in futuristischen Zeiten.
Sarbanes-Oxley
Deutsche Übersetzung
In der Geschäfts- und Finanzwelt sind Verantwortung, Kommunikation und Transparenz das wichtigste Gebot. Leider konnten wir in der Vergangenheit beobachten, dass das Fehlen eines oder all dieser Faktoren der Grund dafür sein kann, dass ein Startup-Unternehmen keine Finanzierung erhält und sogar große Unternehmen dem Niedergang geweiht sind. Das Sarbanes-Oxley Act hat die Art, in der ein großer Teil der Welt miteinander Geschäfte treibt, verändert, und obwohl dieses Gesetz bereits vor mehr als einem Jahrzehnt beschlossen wurde, wirkt es sich bis heute weltweit auf unsere Geschäftstätigkeit aus.
Um zu verstehen, warum Sarbanes-Oxley einen solch starken Einfluss hatte, muss man den Sachverhalt kennen, der zu seiner Entstehung führte. 2002 platzte in Amerika nicht nur die Internet-Aktienblase, sondern es ging auch um Bilanzskandale von Unternehmen wie Enron, Tyco International und Worldcom. Diese Skandale hatten nicht nur die Täuschung von Investoren im großem Stil zu Tage gefördert, die dabei ungeheure Geldsummen verloren hatten, sondern auch den Ruf der gesamten Geschäftswelt beschädigt. Bei einer Prüfung der fraglichen Unternehmen und des regulatorischen Umfelds entwickelte sich der „perfekte Sturm”: die Banken hatten ohne Wahrung der Sorgfaltspflicht Geld an Unternehmen vergeben, bei denen Manager die Gewinnzahlen verfälscht hatten, um sich persönlich zu bereichern; Aufsichtsräte setzten verantwortungslose oder wenig sachkundige Prüfmethoden ein; und den Wirtschaftsprüfern, bei denen möglicherweise Interessenskonflikte vorlagen, überließ man aufgrund einer unterfinanzierten und unterbesetzten SEC die Selbstregulierung.
Das Sarbanes-Oxley Act sollte diese Mängel beheben und zeigte sehr schnell einen direkten und positiven Effekt, der dazu beitrug, das Vertrauen in der Geschäftswelt, bei den Investoren und bei den Konsumenten wieder herzustellen. An der Spitze beginnend stattete Sarbanes-Oxley die SEC mit mehr Machtbefugnissen und mehr Mitteln aus und gab ihr die Aufsicht über die finanzielle Offenlegung. Da eine uneinheitliche und widersprüchliche Rechnungsprüfung der Kern des Problems war, erließ man Richtlinien zur Feststellung der Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer, wodurch Interessenskonflikte vermieden wurden, und gründete das Public Company Accounting Oversight Board, um die Einhaltung von Best-Practice-Standards zu gewährleisten. Gegen eine „Zahlenkosmetik” der Geschäftsführung führte man strengere Strafen für eindeutiger definierte Vorfälle ein und zwang dadurch die Unternehmen wie auch die einzelnen Geschäftsführer, Verantwortung für die Zahlen zu übernehmen, die in den Finanzberichten vorgelegt wurden.
Wir leben heute auf einem Weltmarkt und die Probleme, die mit Sarbanes-Oxley gelöst werden sollten, gab es nicht nur in den Vereinigten Staaten. Auch andere Länder, beispielsweise Kanada, Deutschland und (später) Japan, ergriffen die Initiative und führten ihre eigenen Gesetze nach dem Sarbanes-Oxley-Prinzip ein, um jede Möglichkeit von Widersprüchen oder mangelnder Aufsicht zu bekämpfen. Auf supranationaler Ebene begannen während dieser Zeit viele Länder und auch die EU mit der Einführung harmonisierter internationaler Rechnungslegungsstandards (IFRS). Zwar trugen die Umsetzung von Regulierungsvorschriften im Stil von Sarbanes-Oxley sowie harmonisierte Berichtsstandards dazu bei, ein Umfeld der Ehrlichkeit und der Transparenz zu schaffen, doch bedeutet dies nicht, dass wir jetzt in einer perfekten Welt leben: es gibt immer noch Umsetzungsprobleme (für IFRS) und Kritik hinsichtlich der Wirksamkeit von Sarbanes-Oxley. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass innerhalb Ihres Unternehmens die Standards eingehalten und alle Bereiche und Führungskräfte über die Rolle, die sie hierbei spielen, gut informiert sind, kommt es darauf an, dass alle Aspekte der Regulierung gut verstanden und alle Informationen erfolgreich kommuniziert werden.
Das Sarbanes-Oxley Act markiert einen Meilenstein in der Rechnungslegung und ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle Bereiche der Corporate Compliance. EVS Translations bietet jetzt die deutsche Übersetzung des SOX-Gesetzes an. Der Text wurde von unserem internen Team von deutschsprachigen Übersetzern und Finanzexperten übersetzt. Als Sprachdienstleister für Finanzen und Compliance bieten wir professionelle Sprachdienste in mehr als 50 Sprachen an. Die Qualität unserer Leistungen ist durch unsere Zertifizierungen nach ISO 9001: 2008 und DIN EN15038 garantiert.
Bestellen Sie Ihr Exemplar der deutschen Übersetzung des Sarbanes-Oxley Act (ISBN 978-3-7375-2980-8) unter: http://bit.ly/17Mt2fa.
Sie haben Schwierigkeiten bei der Bestellung oder Fragen zur Veröffentlichung und zum Vertrieb des SOX-Gesetzes? Dann kontaktieren Sie uns unter: [email protected].