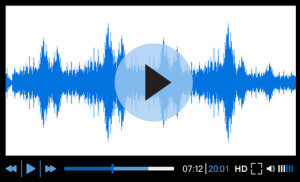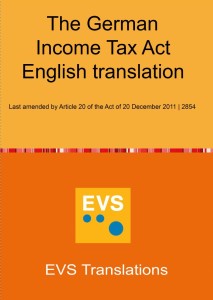Charity – Wohltätigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe – Wort des Tages
Weihnachten ist traditionell die Zeit der Liebe und Wärme, die wir mit unserer Familie und unseren Liebsten verbringen. Wir tauschen Geschenke aus, als Symbole unseres guten Willens, unserer Wertschätzung und Dankbarkeit. Der Akt des Gebens stärkt die Hoffnung auf ein besseres neues Jahr für uns und die ganze Menschheit.
Es ist die Zeit, in der wir Auld Lang Syne singen und auf die guten alten Zeiten anstoßen. Und die Zeit, in der wir auf das zurück blicken, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben, und in der wir hoffentlich alle unser inneres Gleichgewicht finden und zur Ruhe kommen.
Geht es an Weihnachten um Freundlichkeit, Liebe und Zuneigung, dann ist es nur natürlich, dass wir mehr als sonst bereit sind, einander zu helfen, Mitgefühl zu zeigen und einander zu unterstützen. Und eine Möglichkeit, diesen ‚Geist der Weihnacht‘ mit anderen zu teilen, sind Spenden und Wohltätigkeit.
Die Herkunft des Wortes Wohltätigkeit, englisch ‚Charity‘, ist interessant, denn es hat seine Wurzeln im lateinischen cartāt-em, was so viel bedeutet wie „Hochschätzung, Zuneigung“, das später zu caritas (auf Wertschätzung beruhende Liebe) wurde und in diesem Sinne insbesondere im Neuen Testament und im Christentum verwendet wurde. Hiervon ist das altfranzösische Wort charite (Barmherzigkeit) abgeleitet, das später in die englische Sprache aufgenommen wurde. ‚Charity‘ bedeutet also Liebe im christlichen Sinne – sowohl die Liebe Gottes zu den Menschen als auch die Liebe der Menschen zu Gott und zu anderen Menschen.
Einer der frühesten Nachweise in englischen Quellen stammt etwa aus dem Jahr 1175, aus dem letzten Beispiel der altenglischen Sprache, nämlich der Sammlung von Predigten, die man in einem Manuskript in der Bibliothek des Lambeth Palace gefunden hat, bekannt als die Lambeth-Homilien.
Charity bedeutet auch, sich wie ein Christ zu verhalten, und meint in erster Linie die christliche Güte. Einige der frühesten schriftlichen Hinweise finden sich in der Wycliffite Bible, 1380er Jahre.
Heute verwenden wir das Wort Charity allgemein als Synonym für Wohlwollen. In der westlichen Kultur gibt es die so genannten ‚Charity Shops‘, von Freiwilligen betriebene Secondhandläden, in denen gespendete Kleidung und andere Waren günstig angeboten werden. Der Erlös wird wohltätigen Zwecken zugeführt.
Die erste schriftliche Erwähnung des Begriffs Spendengeld stammt von 1711, aus Narcissus Luttrells A brief historical relation of State affairs from September 1678 to April 1714: „Es gab einen Restbetrag der Spendengelder von über 2000£.“
Einer der ersten Secondhandläden in Großbritannien war der der Wolverhampton Society of the Blind in 1899. Von Wohltätigkeitsbasaren war erstmalig in dem klassischen Roman Vanity fair von William Makepeace Thackeray in 1847 die Rede: „Martha malte die wunderschönsten Blumen und bestückte damit die Hälfte der Wohltätigkeitsbasare des Landes.“ Das erste Wohltätigkeitskonzert in den USA ist im Tagebuch von Mary Boykin Chestnut von 1864 dokumentiert.
Piñata – Wort des Tages
Für die meisten ist Piñata ein lustiges Spiel für den Kindergeburtstag. Und das ist nicht ganz falsch, denn Piñata bringt auf jeden Fall Spaß, aber sie hat auch eine reiche Geschichte, die, für viele überraschend, in China begann und etwas mit dem Neujahrsfest zu tun hat.
Historiker glauben, dass der berühmte Reisende Marco Polo der erste Europäer war, der den chinesischen Brauch beobachten konnte, nämlich Hohlfiguren aus farbigem Papier (meist in Form einer Kuh oder eines Ochsen) herzustellen, diese mit verschiedenen Samenkörnern zu füllen und dann anlässlich des Neujahrsfestes mit farbenprächtigen Stöcken darauf zu schlagen, damit das kommende Jahr Fruchtbarkeit und eine reiche Ernte bringt.
Die Venezianer und Italiener brachten den Gedanken dieser frühen Piñatas mit nach Hause und verknüpften ihn im 14. Jahrhundert mit den christlichen Fastenfeierlichkeiten.
Der erste Sonntag der Fastenzeit wurde zum Piñata-Sonntag, abgeleitet von den italienischen Wörtern pignatta (Tontopf) und pigna (Pinienzapfen); die frühen italienischen piñatas waren Töpfe aus Ton in Form von Pinienzapfen.
Der Brauch wurde bald auch in Spanien populär, wo man bei den Fastenfeierlichkeiten Tongefäße verwendete, die man la olla (abgeleitet vom spanischen Wort für Topf) nannte, und von dort brachten im frühen 16. Jahrhundert die spanischen Konquistadoren den Brauch nach Mexiko, wo die Einheimischen Piñata mit vielen volkstümlichen Liedern und Bräuchen begingen.
Die Mexikaner hatten bereits ganz ähnliche Rituale der Azteken und Maya, bei denen die aztekischen Priester anlässlich der Geburtstagsfeierlichkeiten des aztekischen Kriegsgottes mit Federn dekorierte und mit Beeren und Nüssen gefüllte Tongefäße in den Tempeln aufhingen. Wenn der Topf zerbrach und sein Inhalt auf den Boden fiel, war die Gunst der Götter auf der Seite der Menschen. Und bei den Mayas gab es ein Ritual, bei dem Menschen mit verbundenen Augen auf einen an einem Seil aufgehängten Topf schlugen.
Die spanischen Missionare passten diese örtlichen Rituale mit der Gestaltung einer religiösen Piñata an ihre Zwecke an. Sie hatte die Form eines Satelliten mit sieben herausstehenden Kegeln. Diese versinnbildlichten die sieben Todsünden und den Satan, der die Menschen in Versuchung führt, welche mit Stöcken, die ihre Tugend darstellten, gegen diese Versuchung kämpften. Die Süßigkeiten und Früchte, welche die früher verwendeten Samenkörner ersetzten, waren die Belohnung für die Glaubenstreue der Teilnehmer.
Die erste schriftliche Verwendung unseres Wortes in einer britischen Quelle stammt aus dem Jahr 1868 aus einem Reiseführer für Kuba, Puerto Rico und St. Thomas mit dem Titel The Stranger in the Tropics: „Die Pinata ist eine große Papierkugel, die mit den verschiedensten Gegenständen gefüllt ist und an der Decke des Ballsaals aufgehängt wird.“
Die nächste schriftliche Erwähnung findet sich 3 Jahre später und stammt von einer Beobachterin eines Piñata-Festes in Mexiko. 1889 schrieb Fanny Chambers Gooch in Face to face with the Mexicans: „Jetzt beginnt der Spaß des Zerschlagens der piñate. Sie ist an der Decke aufgehängt, und jedermann versucht, mit verbundenen Augen auf die hin und her schwingende piñate zu schlagen.”
Heute hat die Piñata ihren religiösen Charakter meist verloren und ist nur noch Bestandteil der mexikanischen Kunst der cartonería (Skulpturen aus Pappmaché). In vielen Ländern auf der ganzen Welt ist sie aber immer noch Mittelpunkt vieler Geburtstags- und Weihnachtsfeierlichkeiten, an der sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen erfreuen.
Glögg / Glühwein – Wort des Tages
Erhitzter, mit Gewürzen aufgegossener Wein, war in Europa bereits im Mittelalter bekannt und wurde ab mindestens 300 n. Chr. zelebriert, wie die ersten Aufzeichnungen über gewürzten Wein im Römischen Reich belegen. Und mit den römischen Legionären gelangte der gewürzte Wein in alle Länder Europas.
Aber der wirkliche Vorgänger des erhitzten und gewürzten Weins geht vermutlich erst bis in die 1500er Jahre zurück, auf einen Gewürzwein mit dem Namen Hippocras, benannt nach Hippocrates, dem Heilkräfte bei Muskelverletzungen zugeschrieben wurden.
Im 17. Jahrhundert war in Europa eine deutsche Variante des erhitzten Weins (Glühwein) sehr beliebt, die aus Wein, Zucker, Honig, Zimt, Ingwer, Kardamom und Nelken hergestellt wurde, und man sagt, dass der schwedische König Gustav I Vasa, der von diesem deutschen Elixier ziemlich begeistert war, seinen schwedischen Namen, glödgat vin, prägte, wörtlich übersetzt mit „erhitzter Wein“, von glödga (erhitzen, aufwärmen) und vin (Wein).
Der Name Glögg, als Kurzform, erschien in Druckschriften aber erstmalig 1870.
In den folgenden Jahrzehnten wurde er in ganz Europa bekannt und seit den 1890iger Jahren ist er eine Weihnachtstradition, die auch als Gesundheitstrank gegen vielerlei Beschwerden gilt.
Glögg ist das perfekte Getränk, wenn es draußen richtig kalt ist, beim après ski und in der Weihnachtszeit, denn er wärmt gleichzeitig Körper und Seele.
Nach einem Originalrezept von 1898 braucht man für die Zubereitung von Glögg den Bodensatz aus Portweinfässern, einen kräftigen Rotwein, Cognac, Sherry, Zucker, Zimt, Kardamom, Mandeln, Rosinen und Vanilleschoten.
Heutzutage gibt es Glögg in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und mit mehr oder weniger Alkohol, wobei aber der Hauptbestandteil meist immer noch Rotwein (Port oder Bordeaux) ist, und in den verschiedensten Varianten mit Weißwein, Weinbrand, Wodka.... und sogar ohne Alkohol, häufig mit Muskat, Anis, Orangenschalen, Ingwer und sogar mit blanchierten Mandeln, die man den ursprünglichen Zutaten beifügt. Bei der Wahl der Zutaten sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, Kardamom sollte aber immer dabei sein.
Die britischen Leser erfuhren erst 1927 von dem schwedischen Glühwein, und zwar in einem Buch mit dem Titel Sweden: „Schwedischer Punsch zur Kaffezeit und ein sehr wohlschmeckendes Heißgetränk, Glögg genannt, das sich fast so angenehm trinkt wie der erhitzte Bordeaux, für den der High Table des St. John's College in Oxford so berühmt wurde.“
Glögg wird gewöhnlich nach dem Essen, heiß in einem Becher, serviert. In Schweden gibt es dazu meist Ingwer- oder Zitrusplätzchen, außerdem Rosinen und Mandeln. In Norwegen serviert man Reispudding, Risgrøt genannt, und in Dänemark Æbleskiver, luftige Pfannkuchen, mit Zucker bestreut.
In allen skandinavischen Ländern sind Glögg-Partys im Winter sehr beliebt und ein Julebord (vorweihnachtliches Festbankett) wäre ohne Glögg nicht denkbar.
Audiovisuelles Projekt – Lösungen für Unternehmen
Schnelle Lösungen für direkte ‚ad-hoc‘-Übersetzungen werden von zahllosen Sprachdienstleistern angeboten. Wenn es aber um Qualität, einen größeren Umfang oder um komplexere Projekte geht, oder auch um einen regelmäßigen Bedarf, wird die Auswahl an Sprachdienstleistern schon wesentlich kleiner. Für diese Art von Projekten muss man berücksichtigen, ob ein Sprachdienstleister über die richtigen Ressourcen und Prozesse verfügt, um den Anforderungen Ihres Projekts zu genügen.
EVS Translations hatte kürzlich die Gelegenheit, an einem mehrsprachigen audiovisuellen Projekt für ein Fortune-500-Unternehmen unter Beweis zu stellen, welche Lösungen es Unternehmen anbieten kann. Vom Kunden erhielt EVS Translations 21 Videos, die aus 7 Sprachen ins Englische übersetzt werden mussten. Es handelte sich also um ein mehrstufiges Projekt, bei dem es um Transkription, Zeitkodierung, Übersetzung und Untertitelung ging. Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht nicht wirklich kompliziert an, aber bedenkt man, dass 10 GB an Daten auf 21 Übersetzer verteilt werden mussten und als Termin der Geschäftsschluss des nächsten Tages vorgegeben war, dann wären einige Sprachdienstleister sicherlich an ihre Grenzen gestoßen.
Support über Zeitzonen hinweg
Die Verfügbarkeit eines Sprachdienstleisters über Zeitzonen hinweg erweist sich besonders bei Projekten als vorteilhaft, bei denen es um große Volumen und kurze Lieferzeiten geht. Bei diesem speziellen Projekt war EVS Translations in der Lage, auf seine in-house Teams von Übersetzern, Projektleitern und technischen Mitarbeitern in unseren Niederlassungen in Europa und den USA zurück zu greifen. Der durch die verschiedenen Zeitzonen entstehende Zeitvorteil und die Koordination zwischen Teams, die bereits vor Ort waren (unsere in-house Teams) hatte für den Kunden den Vorteil, dass praktisch rund um die Uhr an dem Projekt gearbeitet und somit ein erfolgreicher Abschluss garantiert werden konnte.
Eine umfassende Dienstleistung
Die Botschaft Ihres Unternehmens einheitlich in allen Projekten und Sprachen zu vermitteln erfordert das richtige Management. Hier mit mehreren Anbietern zu arbeiten, macht diese Aufgabe noch wesentlich komplizierter. Einen Anbieter zu finden, der komplette Lösungen anbietet, spart Zeit, ist kosteneffektiv und verbessert die Qualität des fertigen Inhalts. EVS Translations verfügt über IT- und Design-Experten, welche die Projekte sowohl vor als auch nach der eigentlichen Übersetzungsarbeit bearbeiten. Bei dem erwähnten audiovisuellen Projekt erhielten unsere technischen Mitarbeiter die Videos zur Übersetzung, verteilten sie an die internationalen Teams, bearbeiteten Zeitkodierung und Untertitelung, und lieferten anschließend die fertigen Dateien im gewünschten Format an den Kunden. Da diese Experten fest bei uns angestellt sind, war die Abstimmung zwischen Übersetzung und Technik schnell und reibungslos.
Für mich als IT-Manager und Experte für Untertitelungen war die Mitarbeit an diesem Projekt sehr interessant. Die Festlegung des kritischen Wegs und die Beseitigung sämtlicher Hindernisse im Vorfeld waren von kritischer Bedeutung, denn für Fehler blieb keine Zeit. Wir teilten jedes Video in machbare Abschnitte auf und bearbeiteten dann jeden Teil nach unserem Standardverfahren. Die Dateien wurden in Großbritannien zeitkodiert, dann, gegen Ende der Geschäftszeit, baten wir unsere Kollegen in Amerika, uns zu helfen und andere Dinge vorzubereiten, die am nächsten Morgen fertig sein mussten. Wenn eine Datei geliefert wurde, hatte ich Gelegenheit, sie zu prüfen und zu genehmigen, und schließlich wurde alles zu einem lieferfähigen Endprodukt zusammengefügt. Der Kunde hatte geglaubt, dass er Unmögliches verlangt hatte. Umso erfreuter war er dann über den erfolgreichen Abschluss des Projekts.
- David, EVS Translations UK
EVS Translations besitzt Niederlassungen in ganz Europa und den USA, jede mit eigenen, fest angestellten Mitarbeitern für Übersetzung, Projektmanagement und IT, für einen Support über 5 Zeitzonen. Für regelmäßige Kunden kann EVS Translations die Terminpläne dieser internationalen in-house Teams aufeinander abstimmen und so sicherstellen, dass immer dieselben Experten am neuesten Projekt des Kunden arbeiten und sofort mit der Arbeit begonnen werden kann.
Wenn Sie Näheres über die mehrsprachigen Lösungen von EVS Translations für Ihre audiovisuellen Projekte, Ihre Website oder Ihre Druckschriften erfahren möchten, wenden Sie sich heute noch an Ihr Team von EVS Translations vor Ort.
Kardamom – Wort des Tages
Wir alle wissen ja, welches die teuersten Gewürze der Welt sind, nämlich Safran und Vanille. Aber wissen Sie auch, welches Gewürz gleich an dritter Stelle steht? Genau, der Kardamom.
Als eines der wohl ältesten Gewürze der Welt wird Kardamom viel häufiger verwendet, als die meisten anderen Gewürze. In der Küche reicht die Verwendung von süßen und schmackhaften Gerichten bis zu kalten und warmen Getränken.
Die Geschichte des Kardamom reicht mindestens 4000 Jahre zurück und wie viele Gewürze dieser Zeit wurde er hauptsächlich wegen seiner medizinischen Wirkung geschätzt.
Die Griechen und Römer verwendeten Kardamomgewürz für Parfums, Salben und ätherische Öle und auch in den meisten religiösen Opfergaben spielte es eine Rolle.
Die Wikinger entdeckten das Gewürz vor etwa tausend Jahren auf ihren Reisen nach Konstantinopel und brachten es nach Skandinavien, wo es heute eine der wichtigsten Zutaten für den traditionellen Glögg (Glühwein) ist.
Im 3. Jahrhundert n. Chr. stand Kardamom in Alexandria auf der Liste der steuerpflichtigen indischen Gewürze und Indien behielt seine Stellung als weltweit größter Kardamomexporteur bei, bis es im späten 20. Jahrhundert von Guatemala abgelöst wurde, wo der deutsche Kaffeepflanzer Oscar Majus Kloeffer in den 1920iger Jahren die Kultivierung des indischen Kardamom einführte.
Das Wort Kardamom stammt von der mittelenglischen Ableitung der beiden frühgriechischen Wörter zur Bezeichnung der beiden wichtigsten Arten des Gewürzes, die den Griechen bekannt waren - kardamon (Kresse) und amōmon (Gewürzpflanze), die später dann einfach als kardamōmon bezeichnet wurden.
Die beiden wichtigsten Varianten sind: Elettaria, auch bekannt als echter Kardamom, mit hellgrünen Schoten, hauptsächlich bekannt von Indien bis Malaysia, und Amomum, mit größeren, dunkelbraunen Schoten, hauptsächlich verwendet in Asien und Australien. Von hier stammen die Bezeichnungen grüner und schwarzer Kardamom.
Die Verwendung von Kardamom als Verdauungshilfe ist seit Anfang 1800 enorm gestiegen, aber seine magenberuhigenden Eigenschaften waren schon lange vorher bekannt, wie man aus der ersten schriftlichen Erwähnung in einer britischen Quelle schließen kann. Unser Wort tauchte erstmalig gedruckt in John Trevisas Übersetzung der frühen Enzyklopädie De Proprietatibus Rerum (Über die Eigenschaften der Dinge) auf: „Kardamom hilft gegen Beschwerden und Irritationen des Magens.”
Kardamom verwendet man für eine Vielzahl von Hauptgerichten und Suppen, beispielsweise Reis und Curry, bis hin zu Getränken wie Chai und Tee, und die Kombination aus Kardamom, Nelken, Zimt, Koriander, Fenchel und Sternanis ist typisch für viele weihnachtliche Leckereien, von Lebkuchen bis Glühwein.
Tarot – Wort des Tages
Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht einmal gerne in die Zukunft blicken würde. Klappt es mit meinen Plänen? Wie soll ich mich im einen oder anderen Fall entscheiden? Und was wäre wenn…?
Läuft Ihnen vielleicht ein Schauer über den Rücken oder werden Sie zumindest ein wenig unruhig und fühlen sich irgendwie unbehaglich, wenn es um Wahrsagerei geht? Dabei geht es vielleicht nicht so sehr um Aberglaube oder Skepsis, sondern es ist einfach das Unbekannte, das uns verunsichert. Es ist die universelle Kraft des Unvorhersehbaren, die jeden von uns unvorbereitet treffen kann, selbst die, die in ihrem Leben nichts dem Zufall überlassen. Dieses unbehagliche Gefühl, wenn man auf einem Jahrmarkt oder in einem Vergnügungspark das Zelt der geheimnisvollen alten Dame mit der unvermeidlichen Kristallkugel und den Tarotkarten sieht.
Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie wir einfach etwas übernehmen, ohne allgemein verbreitete Ansichten einmal tatsächlich zu hinterfragen.
Die Tarotkarten beispielsweise werden generell für ein Deutungswerkzeug gehalten. Vielleicht aber dienen sie heutzutage weniger der Zukunftsvorhersage, sondern vielmehr als Erklärung und als Blick auf die Gegenwart, zur besseren Wahrnehmung einer aktuellen Situation und schließlich einer neuen Perspektive, als alternatives psychotherapeutisches Verfahren, mit dem Unterbewussten zu arbeiten und am Ende mehr über sich zu erfahren.
Das Wort Tarot kam im 16. Jahrhundert in die englische Sprache und ist direkt aus dem Französischen entlehnt. Ursprünglich kommt es aus dem Italienischen, abgeleitet vom Namen der Spielkarten tarocchi (Singular tarocco), und stammt offensichtlich aus dem nördlichen Italien des 14. Jahrhunderts. Der Name der Karten ist der Theorie nach vom Namen des Flusses Taro in dieser Region abgeleitet.
Eine andere Theorie verknüpft die Etymologie des Wortes mit dem Arabischen turuq, in der Bedeutung ‚Wege‘.
Auch wenn die Herkunft eher unsicher ist, so wurden die Tarotkarten in Europa anscheinend sehr schnell bekannt und man verwendet sie für zahlreiche Spiele.
Anfänglich hatte das Tarot-Deck, das aus insgesamt 78 Spielkarten besteht – 22 Bildkarten, plus 56 Karten in vier Farben - nichts obskures und geheimnisvolles.
Aber zweihundert Jahre später finden wir einen schriftlichen Beweis für die Verwendung der Tarotkarten zur Weissagung, und zwar in dem Buch The Oracles of Francesco Marcolino da Forlì von 1540, in dem die Karten zur Wahl eines beliebigen Orakels dienen, jedoch selbst keine eigene Bedeutung haben.
Ein halbes Jahrhundert später tauchte das Wort erstmalig gedruckt in einer britischen Quelle auf, in seiner ursprünglichen Bedeutung als Spielkarte. Das war 1592, in De La Mothes Werk French Alphabet: „Spielt Ihr an Tischen, mit Würfeln, Tarotkarten, Schach?”.
In den 1770igern veröffentlichte Antoine Court de Gébelin, ein in Frankreich geborener protestantischer Pastor, eine Dissertation über die Ursprünge des Symbolismus im Tarot. Für ihn liegt ihr Ursprung im alten Ägypten und er ist überzeugt, dass die Bildkarten des Tarot die Theologie des alten Ägypten darstellen.
Im Laufe der Zeit wurden Tarotkarten von Sammlern als Kunst gepriesen. So berichtete The Fortnightly Review, – eines der prominentesten und einflussreichsten Magazine im England des neunzehnten Jahrhunderts, in 1899: „Piot..war..der Erste, der ‘Tarots’, jene wertvollen Spielkarten, sammelte, die jetzt einen derart hohen Preis erzielen.“
Das deutsche Einkommensteuergesetz auf Englisch
EVS Translations veröffentlicht die englische Übersetzung des deutschen Einkommensteuergesetzes
Nach dem Erfolg der deutschen Übersetzung des Sarbanes Oxley Act bringt EVS Translations die nächste Fachübersetzung für Unternehmen, Investoren und all diejenigen auf den Markt, für die internationale Finanzregelungen und –gesetzgebungen von Interesse sind. Im November veröffentlichte EVS Translations die englische Übersetzung des deutschen Einkommensteuergesetzes, das zweifellos Maßstäbe für alle künftigen englischen Übersetzungen dieses Gesetzes setzen wird.
Wer braucht diese Übersetzung?
Diese maßgebliche Übersetzung des Einkommensteuergesetzes wird sich als wichtige Lektüre für Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in oder mit Deutschland, Hedgefonds-Investoren, Einzelpersonen mit Anteilen an deutschen Firmen und Ausländer erweisen, die derzeit in Deutschland ansässig sind. Wie viele Steuern muss ich auf meine Einkünfte zahlen? Wie sehen die Gesetze zur Doppelbesteuerung aus? Diese präzise Wiedergabe des deutschen Einkommensteuergesetzes in englischer Sprache ermöglicht allen Englisch Sprechenden den einfachen Zugang zu Informationen, so dass sie sicher sein können, bezüglich der in Deutschland zu zahlenden Einkommensteuer auf dem Boden des Gesetzes zu stehen.
Unsere Erfahrung
EVS Translations besitzt über 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen im Finanzsektor. Unsere fest angestellten Teams von Finanzübersetzern in jeder unserer internationalen Niederlassungen übersetzen ausschließlich in ihre Muttersprachen und liefern dadurch herausragende Übersetzungen. Wenn Sie zuverlässige und aktuelle Informationen brauchen, dann ist EVS Translations Ihr Partner des Vertrauens.
Wie bekomme ich die Übersetzung?
Bestellen Sie Ihr Exemplar der englischen Übersetzung des deutschen Einkommensteuergesetzes (ISBN 978-3-7375-6344-4) online über epubli (http://www.epubli.de/) zu einem Preis von € 129.00.
Bei Fragen zur Bestellung oder Übersetzung, zur Veröffentlichung und zum Vertrieb des deutschen Einkommensteuergesetzes können Sie sich gerne per E-Mail unter marketing(at)evs-translations.com oder telefonisch unter der Nummer +49 69 829799 – 55 an uns wenden.
Solidarität – Wort des Tages
In vielerlei Hinsicht sieht es so aus, als sei die moderne Kommunikationstechnologie zu einer Art Büchse der Pandora geworden. Sie liefert uns alle Arten von Informationen von überall in der Welt und man kann sie überallhin mitnehmen. Aber manchmal ist es genau das, was uns, als Einzelmenschen, von den Ereignissen entfernt, uns hilflos und unbedeutend fühlen lässt. Nehmen wir einmal die tragischen Ereignisse in Paris – das Mitgefühl, Verständnis und die Einigkeit, die durch unser heutiges Wort gefördert werden, kann jeden befähigen, ein Teil der Lösung und nicht mehr nur Beobachter der Szene zu sein. Und genau deswegen war in den letzten Tagen ein ganz bestimmtes Wort in aller Munde. Zwar bleibt es häufig, und das ist traurig, den schlechtesten Zeiten vorbehalten, doch kann Solidarität, richtig eingesetzt, das widerspiegeln, was der amerikanische Präsident Abraham Lincoln in seiner Antrittsrede als „die besseren Engel unseres Wesens“ bezeichnete.
Für viele von uns, die ein bestimmtes Alter überschritten haben, ist die Definition von Solidarität so eng mit der unabhängigen polnischen Arbeiterbewegung Solidarność, was in der Übersetzung „Solidarität“ bedeutet, Anfang der 1980er Jahre verknüpft, dass man kaum glauben kann, dass seine Geschichte wesentlich weiter zurückreicht und viel verzweigter ist. Das Wort tauchte im Englischen im frühen 19. Jahrhundert auf und leitet sich von Französisch solidarité ab, und das wiederum stammt vom lateinischen Wort solidum, was so viel bedeutet wie „ganze Summe“. Und genau diese „Ganzheit“ oder Einheit verleihen dem Wort Solidarität seine Stärke.
Der Ausdruck dieser Stärke scheint sich jedoch, ohne zu tief in die Philosophie oder das logische Denken abzutauchen, auf 2 Denkrichtungen aufzuteilen. Der universellere Ansatz, beispielsweise die katholische Soziallehre und die Arbeiten des russischen Fürsten Pjotr Kropotkin, legt nahe, dass es bei Solidarität eher um das instinktive Verstehen und darum geht, das zu tun, was getan werden muss, um anderen zu helfen und dem allgemeinen Wohl der Gesellschaft zu dienen. Emile Durkheim vertrat eine weniger altruistische Ansicht und betrachtete die Solidarität als etwas, das im besten Interesse einer jeden Gruppe ist, beispielsweise zur Unterstützung einer Familie oder eines Stammes. Und in komplexeren Zusammenhängen, wie dem uns allen bekannten polnischen Beispiel, nehmen einzelne Gruppen, beispielsweise Gewerkschaften, ihre Interessen wahr unter der Annahme, dass es für die allgemeine Besserstellung der Gesellschaft unter allen Gruppen ebenfalls Interdependenz/wechselseitiges Vertrauen gibt.
Die erste bekannte Verwendung des Wortes Solidarität im Englischen findet sich in dem 1841 erschienenen Werk von Hugh Doherty, False Association & Its Remedy, wo es ganz einfach als „kollektive Verantwortung“ definiert wird. Ralph Waldo Emerson gebrauchte das Wort eher in einem nationalistischen Sinne. Er schrieb in English Traits (1856) über England: „Ein Geheimnis seiner Macht ist das gegenseitige Verstehen…sie haben Solidarität, oder fühlen Verantwortung, und sie vertrauen einander“. In dem Verständnis, dass es Solidarität eigentlich zwischen allen Objekten geben kann, die für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeiten, stellte George P. Marsh fest: „Die Sprachorgane agieren und reagieren aufeinander;..es herrscht zwischen ihnen, um einmal ein Wort zu benutzen, das jetzt noch nicht Englisch ist, aber sicher bald sein wird, eine gewisse Solidarität“.
Michelin-Führer – Wort des Tages
Wir haben alle schon von den Restaurantempfehlungen des Michelin-Führers gehört oder sind ihnen gefolgt. Aber nicht jeder verbindet diesen angesehenen Restaurantführer direkt mit der Reifenfirma desselben Namens.
Dennoch begann seine Geschichte mit einer cleveren Marketing-Idee eben dieser Reifenfirma. Die Geschichte eines der drei größten Reifenhersteller, Michelin, begann 1889 mit einer kleinen Gummifabrik, und setzte sich 1891 mit dem ersten Patent für einen abnehmbaren, mit Luft gefüllten Reifen fort.
Obwohl zur damaligen Zeit nur sehr wenige motorisierte Fahrzeuge auf den Straßen Frankreichs unterwegs waren, waren die beiden Firmengründer, die Brüder Michelin, entschlossen, das Auto von einer Neuheit, die man nur an Sonntagen für kurze Picknickausflüge nutzte, zu einem Massentransportmittel über große Distanzen zu machen.
Um die Nachfrage der Kunden nach ihren Produkten zu steigern, entwickelten sie ein brillantes Marketingkonzept, um das Reisen über längere Strecken anzukurbeln. Sie veröffentlichten einen Auto-Reiseführer, in dem Hotels, Mechaniker und Tankstellen in ganz Frankreich verzeichnet waren.
Der erste Michelin-Führer (Französisch: Guide Michelin) wurde 1900 veröffentlicht. Die Firma wuchs mit ihrem Reiseführer und bald gab es Ausgaben für andere Länder, angefangen mit dem Michelin-Führer für Belgien im Jahr 1904, bis dann 1910 die ersten Autokarten eingeführt wurden.
Aber erst 1926 wurde der Reiseführer um etwas erweitert, das ihn letztlich berühmt machte — eine Auflistung der besten Gourmet-Restaurants. Und 5 Jahre später führte man das Drei-Sterne-System ein, zunächst in den französischen Provinzen, 1933 dann auch in Paris. In diesem Jahr wurden in Frankreich 23 Restaurants mit drei Sternen bewertet.
Nach dem Bewertungssystem des Michelin steht ein Stern für ein „sehr gutes Restaurant in seiner eigenen Kategorie“, zwei Sterne stehen für „hervorragende Küche, einen Abstecher wert“, und drei Sterne blieben einer „außergewöhnlichen Küche, eine Sonderfahrt wert“ vorbehalten.
Die erste Erwähnung des Namens der französischen Reifenfirma in den englischen Printmedien fand sich nur 3 Jahre nach ihrer Gründung, aber offensichtlich reichte diese kurze Zeit aus, um den Reifen zur bevorzugten Marke zu machen. 1902 schrieb das Magazin Motors and Motor-Driving über den „Reifen, der im Ausland als der beliebteste bekannt ist, der Michelin“.
Und der Michelin-Führer wurde erstmalig von einem englischen Autor im Jahr 1921 erwähnt, und zwar in William John Lockes The mountebank. Das Buch erzählt die Geschichte eines Waisenjungen, der ein fahrender Gaukler wird: “Die Nebenbeschäftigungen, die dazu geführt hatten, dass er die Gasthäuser Frankreichs so gut kannte, wie der Michelin-Führer.“
Die erste Stadt, die einen Michelin-Stern erhielt, wird in dem englischen Spuk-Roman The IPCRESS File erwähnt. Der Roman, der sich mit der Gehirnwäsche im Kalten Krieg befasst, enthält Szenen in der französischen Stadt Joigny, die der Autor Len Deighton als „eine Stadt mit Michelin-Stern, etwa hundert Kilometer südlich von Paris“ beschreibt.
Und damit kommen wir zu der britischen Kochbuchautorin Elizabeth David, die sich in ihrem 1960 erschienenen Buch French provincial cooking ein wenig skeptisch über die Stern-Vergabekriterien des Michelin-Restaurantführers äußert: „Ein genauerer Blick auf die Spezialitäten der Restaurants, die im Michelin und anderen Restaurantführern genannt werden, zeigt, dass nicht wenige von ihnen ihren Stern irgendeiner Art von Wurst oder Pastete verdanken.”
Das erste britische Restaurant, das einen Michelin-Stern erhielt, war 1974 das Le Gavroche in London.
Zwar hat der Michelin-Führer viele Kritiker, wenn es um seine Bewertungskriterien und das Propagieren einer bestimmten Esskultur geht, die nicht ganz den modernen Geschmack widerspiegelt, und sieht sich vor allem einer starken Konkurrenz durch Restaurantempfehlungen über das Internet gegenüber. Doch sollte man keinesfalls seine Geschichte und den Ruf verkennen, die ihm seinen Spitznamen Die Bibel der Gastronomen eingebracht haben.
Drehkreuz baltischer Zuwanderer für die Verbindung zur Heimat
Als 2004 die Baltischen Staaten in die Europäische Union aufgenommen wurden, hofften die führenden Politiker von Estland, Lettland und Litauen auf einen hohen Lebensstandard für ihre Länder. Aber die Realität sah anders aus – Tausende, insbesondere junge, gut ausgebildete Menschen haben in den letzten zehn Jahren diese drei Länder verlassen.
Die Migrationsstatistik der drei baltischen Staaten zieht eine ähnliche Bilanz. Die Bevölkerung Lettlands schrumpfte von 2,7 Millionen in 1991 auf heute 1,97, in Litauen waren es 1991 noch 3,7 Millionen Menschen, heute sind es nur noch 2,9 Millionen, und in Estland sind von 1,6 Millionen in 1991 bis heute noch 1,3 Millionen Menschen im Land verblieben. Der europäische Pass öffnete die Tore für die Migration, hauptsächlich in die benachbarten skandinavischen Länder, nach Großbritannien und nach Deutschland.
Und wie viele ‚Expats‘ wissen, die Liebe zum Heimatland und das Bedürfnis, sich mit seinen Wurzeln verbunden zu fühlen, scheint sich irgendwie zu vervielfältigen, wenn man in einem fremden Land lebt.
Und damit kommen wir zu DELFI (delfi.ee) – dem bei Internet-Usern aus dem Baltikum wohl populärsten Internetportal, das nach den weltweiten Top-Portalen – Google, Facebook und YouTube einen hohen Stellenwert besitzt.
Seit seinem Start in 1999 zählt Delfi heute zu einem der wichtigsten Portale und bietet Neues aus Politik, Wirtschaft und Technik, zu Lifestyle und Gesundheit, Horoskope, Spiele, TV-Programme, Wechselkurse, Wettervorhersagen und viele soziale Interaktionsplattformen und anwendererzeugte Inhalte, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene.
Neben den Amtssprachen der Baltischen Staaten bietet Delfi außerdem die Sprachen Polnisch, Englisch und Russisch an.
Und es ist nicht überraschend, dass es zu den 500 meistbesuchten Websites in allen benachbarten skandinavischen Ländern zählt, und außerdem zu den 10 000 meistbesuchten Websites in Großbritannien und Deutschland – den Ländern mit dem größten Einwandererzustrom aus dem Baltikum. Nicht zu vergessen die Statistiken, nach denen die englische Version erstaunlicherweise zu den 1000 meistbesuchten Websites in Großbritannien zählt. Die Erklärung hierfür liegt auf der Hand – Menschen aus Estland, Lettland und Litauen, die im Ausland leben, arbeiten oder studieren, nutzen Delfi, um sich über die Geschehnisse in ihren Heimatländern auf dem Laufenden zu halten und berichten ihren neuen Englisch sprechenden Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern von Neuigkeiten aus der Heimat. Natürlich wird delfi.ee im Ausland häufiger von Nutzern im Alter zwischen 25-34 besucht, die einen College-Abschluss besitzen – und hierin spiegelt sich wohl auch das Profil des typischen baltischen Einwanderers wider.
Vor einigen Monaten sprach sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gegen Delfi aus, weil er das Portal für Hasskommentare von Nutzern verantwortlich machte, was eine ernste Debatte über die Freiheit der Meinungsäußerung im Internet auslöste.
Delfi bietet seinen Nutzern die Freiheit, eine Verbindung zu ihrem Heimatland herzustellen und ist ein wundervolles Beispiel dafür, dass man auch von zuhause aus global sein kann. Eine Übersetzungsfirma ist nicht notwendig. Keine mehrsprachige SEO-Optimierung, keine Lokalisierung. Ihr Ziel ist es, lokaler zu sein – zuhause und in der Ferne.